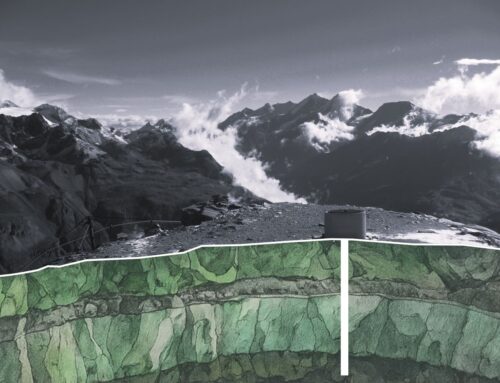Management & Tourismus, SI 5/2025
KI vs. Mensch: Wie autonome Seilbahnen Vertrauen gewinnen
Ein sonniger Julitag an der Talstation der neuen Panorama-Ausflugsbahn. Eine rüstige Wanderin steht vor der automatischen Tür. Keine Mitarbeitenden weit und breit, nur ein leiser Piepton, QR-Codes und Touchscreens. Sie zögert. Wen kann sie fragen, wenn sie Hilfe braucht?
Ein paar Stunden später erlebt ein junger Mann das Gegenteil: Bei einer alten Standseilbahn fehlt ihm die Technik – keine Anzeigen, keine Sensorik, nur manuelle Bedienung und damit fehleranfällig. Auch er fühlt sich unsicher. Zwei Generationen, zwei Perspektiven – doch das gleiche Bedürfnis: Verlässlichkeit und Vertrauen.
Technik braucht Vertrauen
Neue autonome Seilbahnen bieten zahlreiche Vorteile. Algorithmen optimieren Fahrpläne in Echtzeit und reduzieren Wartezeiten. Sensoren überwachen die Technik rund um die Uhr. Fehlerquellen werden früh erkannt, Notfalleinsätze automatisch ausgelöst.
Auch ökologisch punkten die Systeme: Energie wird rekuperiert, Leerfahrten werden vermieden – und das Fahrgefühl ist leiser und komfortabler denn je. Doch die beste Technik hilft wenig, wenn Gäste ihr nicht vertrauen und der Zugang Unbehagen auslöst.
Autoren:
Dieser Fachartikel wurde verfasst von Adrian Bühlmann, Samuel Hecht und Falko Küker (v. l.). Sie sind Teilnehmer des Executive MBA der Hochschule Luzern – Wirtschaft.

Ältere Menschen fürchten Bedienungsfehler oder fehlende Hilfe im Notfall, Jüngere wollen sichtbare Kontrolle und Interaktivität. Was hilft? Transparente und moderne Kommunikation – etwa durch leicht verständliche Erklärvideos und visuelle Signale.
Persönliche Begleitung durch geübte Gästebegleiter an Schlüsselstellen. Und einfache, intuitive Bedienung mit klaren Symbolen und wenigen Knöpfen. Vertrauen entsteht durch positive Erlebnisse: Technikführungen, spielerische Wissensvermittlung und persönliche Tipps steigern die Akzeptanz.
Nicht nur Technik planen – auch Erlebnis gestalten
Wer den Wandel aktiv gestaltet, kombiniert Technik und Gästeorientierung von Anfang an: Bereits bei der Konzipierung von neuen Anlagen mit autonomem Betrieb sollten nebst den technischen Abläufen auch die Anforderungen aus Gästesicht einfließen.
Bisher werden Kundenkontaktpunkte, Lenkungs- und Kommunikationskonzepte nicht mit der gleichen Aufmerksamkeit bei der Planung und Umsetzung neuer Anlagen berücksichtigt.
Der Fokus liegt oft stark auf technischen Aspekten wie Transportkapazität, Windstabilität, Linienführung oder Naturschutz. Künftig muss das Erlebnis der Gäste stärker berücksichtigt und der persönliche Kontakt aktiv in Prozesse eingeplant werden.
Warum nicht auch Fachleute aus den Bereichen Hospitality und Tourismus frühzeitig beiziehen, welche Erfahrung mit automatischem Check-in und mit Gästebedürfnissen haben?
Oder Gäste mit einem kühlen Getränk aus dem Barwagen begrüßen, damit die Bahnfahrt selbst bereits zum Erlebnis wird?
Auch der Umgang mit Herausforderungen wie Overtourism erfordert beispielsweise eine differenzierte Ansprache von Einheimischen gegenüber Touristen und Touristinnen – ein neuer Umgang, der Vertrauen schaffen kann. Durch die neue Qualität der Kontakte können auch zu diesem Thema weitere Chancen entstehen.

Mitarbeitende dort einsetzen, wo sie wirken
Ein zentraler Pool aus ausgebildeten Seilbahnmechatronikern, -fachleuten und technischen Leitenden ermöglicht, dass stets das richtige Personal am passenden Ort verfügbar ist – sei es an unterschiedlichen Anlagen oder über betriebliche Einsatzorte hinweg.
In Einsatzzentralen wird die technische Überwachung aller Anlagen gebündelt und durch schnelle Einsatzteams ergänzt, die bei Bedarf kurzfristig reagieren können. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass technische Spezialisten und Spezialistinnen vorrangig für ihre Kernaufgaben eingesetzt werden können und nicht – oder weniger – zur Gästebetreuung.
Somit kann die Kommunikation mit den Gästen im Zuge der zunehmenden Automatisierung neu gedacht und gestärkt werden. Indem einfache Routineaufgaben automatisiert und technische Spezialisten fachgerecht eingesetzt werden, entsteht für die Mitarbeitenden mehr Raum für vielfältigere und interessantere Tätigkeiten – insbesondere für den direkten Gästekontakt.
So können gezielt Mitarbeitende eingesetzt werden, die Freude am Umgang mit Menschen haben und über ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten verfügen. Das erfordert ein neues Mitarbeiterprofil: service- und erlebnisorientiert, digital affin und technisch interessiert.
Szenario B:
Die ältere Frau betritt die Station der autonomen Seilbahn, wird jedoch von einer Mitarbeiterin empfangen und beraten.

Begrüßt, begleitet, begeistert
Wenige Wochen später betritt die rüstige Wanderin erneut die Station. Diesmal empfängt sie eine freundliche Mitarbeiterin, erklärt das System, gibt Tipps zum Tagesprogramm. Die Türen öffnen sich – und sie steigt ein, mit einem Lächeln. Technik und Mensch wirken zusammen, so wie es auch der junge Mann zeitgemäß erwartet.
Nicht anonym, sondern persönlich. Nicht kompliziert, sondern verständlich. So entsteht Vertrauen – und aus Unsicherheit wird Begeisterung. Autonome Seilbahnen sind mehr als ein Effizienzprojekt.
Sie bieten die Chance, Technik und Menschlichkeit neu zu verbinden. Wer Vertrauen schafft und das Gästeerlebnis bewusst gestaltet, gewinnt nicht nur Effizienz und Nachhaltigkeit – sondern das, was im Tourismus zählt: echte Begeisterung.