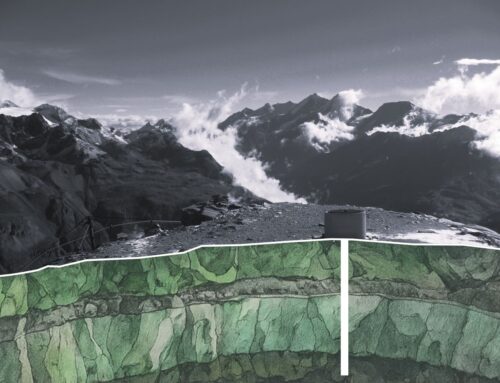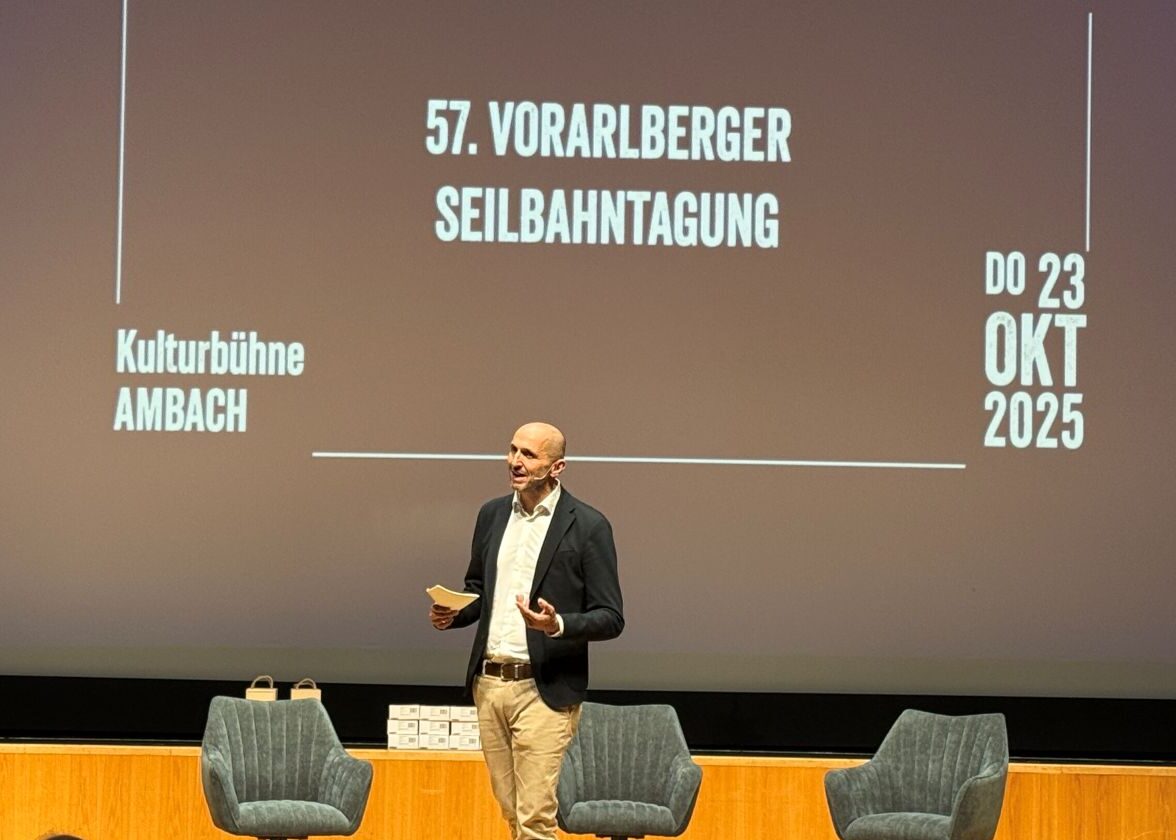
Management & Tourismus, Planen & Bauen
Vorarlberger Seilbahntagung: Tagestourismus als Chance, Bürokratie als Bremse
Wie wichtig der Tagestourismus für Vorarlbergs Bergregionen und welche wirtschaftlichen Chancen liegen darin? Und wie können Infrastruktutprojekte am berg entbürokratisiert werden?. Diese beiden Themen prägten die 57. Vorarlberger Seilbahntagung, die am 23. Oktober 2025 in Götzis stattfand.
Tagesgäste als potenzieller Markt
Rund 7,5 Millionen Tagesgäste zählte Vorarlberg im vergangenen Tourismusjahr – und damit fast so viele wie Nächtigungsgäste: Diese lagen im Tourismusjahr 2024 bei rund 9,5 Millionen.
Diese Zahlen stellte Roland Scherer, Direktor des Instituts für Systemisches Management und Public Governance an der Universität St. Gallen, in seinem Vortrag vor. Dort wird derzeit eine umfassende Studie zum Tagestourismus in Vorarlberg durchgeführt.
Die Ergebnisse sind zwar noch nicht endgültig, doch der Forscher präsentierte erste spannende Einblicke: Etwa 40 bis 50 Prozent der insgesamt 7,5 Millionen Tagesgäste sind aus Vorarlberg selbst. Rund 30 Prozent kommen aus Deutschland und etwa 20 Prozent aus der Schweiz.
„Das heißt, Tagesgäste leisten einen wichtigen Beitrag zu den Umsätzen“, so Scherer. „Sie bringen im Endeffekt die Grundfinanzierung mit. Wenn wir die touristischen Umsätze hochrechnen, sprechen wir von rund 400 bis 500 Millionen Euro – etwa die Hälfte davon kommt von den Vorarlbergern selbst.“
Roland Scherer von der Universität St. Gallen
präsentiert vorläufige Ergebnisse der Studie zum Tagestourismus in Vorarlberg.

Auswahlfaktoren und Ausgaben der Tagesgäste
Gute Erreichbarkeit, Gewohnheiten und Empfehlungen spielen laut Umfragen eine entscheidende Rolle bei der Wahl einer Destination.
Die Wiederholungsbesuche sind im Wintertourismus besonders stark ausgeprägt: Gäste besuchen oft dieselben Skigebiete, weil sie sie bereits kennen. Das ist nicht der Verdienst von Marketingaktivitäten, sondern vor allem von der Mund-zu-Mund-Propaganda.
Interessant ist, dass die durchschnittliche Anreiseentfernung im Winter etwa doppelt so groß ist wie im Sommer. Das bedeutet, dass das Einzugsgebiet der Bergbahn im Winter deutlich größer ist – etwa doppelt so groß wie im Sommer. Betrachtet man die Zeit, liegt die durchschnittliche Anreisezeit im Sommer nur bei der Hälfte der Winterzeit.
Laut Scherer geben Tagesgäste durchschnittlich zwischen 30 und 50 Euro im Sommer und zwischen 70 und 80 Euro im Winter aus.
Entwicklungsempfehlungen
Scherer zufolge sollten diese Faktoren bei der Tourismusentwicklung berücksichtigt werden.
„Das sind Leute, die die Region bereits kennen. Wir brauchen hier auch entsprechende Konzepte.“
Außerdem empfiehlt er, dass tagestouristische Marketingaktivitäten in Vorarlberg gezielt auf den deutschen Markt ausgerichtet werden sollten – insbesondere auf diejenigen Städte, für die die Skigebiete in Vorarlberg die nächstgelegenen Berge darstellen.

Herwig Ganahl (GrECo International AG) und Klaus Nussbaumer (Lech Bergbahnen AG).

Networking auf der Tagung.

Christian Felder (Fachverband Österreichischer Seilbahnen), Andreas Natter (Doppelmayr) und Christian Weiler (Klenkhart & Partner).
Entbürokratisierung als Notwendigkeit
„In der Anfangszeit wurde drei Monate geplant und drei Jahre gebaut; heute wird drei Jahre geplant und drei Monate gebaut.“
Mit diesem Zitat von Heinrich Klier fasste Christian Weiler, Geschäftsführer von Klenkhart & Partner, seinen Vortrag zusammen. Er berichtete über seine Erfahrungen mit bürokratischen Verfahren bei der Planung von Seilbahnen in Bayern und in den österreichischen Bundesländern.
Laut Weiler waren in Bayern aufgrund sehr niedriger UVP-Schwellenwerte fast alle Projekte UVP-pflichtig. Gleichzeitig sei der Prozess einfacher und schneller als in Österreich:
„Ein Großteil der UVP-Verfahren, die wir eingereicht haben, wurde im Schnitt nach dreieinhalb bis viereinhalb Monaten mit einem positiven UVP-Genehmigungsbescheid abgeschlossen“, so Weiler.
Problematisch sind in Bayern jedoch hohe Ausgleichszahlungen für Eingriffe in den Naturraum, insbesondere aufgrund der Bayerischen Kompensationsverordnung.
Als Beispiel nannte Weiler Garmisch: Dort werde eine neue Seilbahn genau auf der Stelle einer bestehenden Anlage gebaut. Da sich in der Nähe ein EFH-Gebiet (Gebiet mit europäischem Schutzstatus) befindet, wurde die Höhere Naturschutzbehörde einbezogen. Sie bezeichnete das Projekt als vergleichbar mit dem Bau einer Autobahn. In der Folge wurde eine Ausgleichszahlung von 1,2 Millionen Euro festgelegt.
„Das Genehmigungsverfahren an sich bleibt formal positiv, aber die Ausgleichszahlungen sind völlig überzogen, weil die falsche gesetzliche Grundlage verwendet wird. Besonders öffentliche Institutionen haben dies zum Geschäftsmodell gemacht: Sie stellen solche Ausgleichsflächen bereit und verlangen dafür zwischen fünf und sechs Euro pro Quadratmeter“, erklärt Weiler.
In Österreich werden aufgrund hoher UVP-Schwellenwerte UVP-Verfahren selten durchgeführt, und die Verfahren sehen in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich aus.
Im Vergleich zu Bayern sind die Genehmigungsverfahren in Österreich deutlich komplexer und zeitaufwendiger. In Salzburg, Tirol und Vorarlberg müssen Projekte meist mehrstufige Prüfungen, Vorprüfungen und eigene naturschutzrechtliche Verfahren durchlaufen.
Franz Hörl
Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen.

Franz Hörl: Entbürokratisierungsinitiative in der Bundesregierung
Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen, teilte im SI Interview seine Sicht auf die bürokratischen Herausforderungen im Seilbahnbereich:
„Die Problematik besteht darin, dass Seilbahnen eigentlich beim Verkehrsministerium angesiedelt sind und dort verhandelt werden, während die Genehmigung letztlich teilweise wieder von den Bundesländern erteilt wird. Beispielsweise wird bei einer Achter-Sesselbahn das Projekt in Wien verhandelt, abgenommen wird es aber vom Land. Das sollte geändert werden: Es müsste eine Instanz geben, die sowohl die Bauverhandlungen führt als auch die Genehmigung erteilt.“
Obwohl Hörl betont, dass in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden, oft abhängig von den jeweiligen Sachverständigen, besteht das grundsätzliche Problem überall dasselbe.
„Aber grosso modo glaube ich, dass wir in Österreich dasselbe Problem haben wie andere Demokratien in Mitteleuropa: Die Regulierung, angefangen in Brüssel, aber auch in den Nationalstaaten, hat ein Ausmaß erreicht, bei dem wir manchmal einfach den Reset-Knopf drücken müssten“, so Hörl.
Auf die Frage von SI, was der Fachverband unternimmt, um die Bürokratie zu reduzieren, erklärte Franz Hörl, dass es in dieser Bundesregierung eine Entbürokratisierungsinitiative gibt. Laut dem Obmann, treibt der Staatssekretär Sepp Schellhorn dieses Thema gemeinsam mit Alexander Pröll, der ebenfalls Staatssekretär ist, voran.
„Wir haben eine komplette Liste übergeben, in der wir aufgezeigt haben, wo aus unserer Sicht Bürokratie abgebaut werden kann“, berichtet Hörl. „Das betrifft auch das, worüber ich bereits gesprochen habe: dass eine einzige Instanz die Bauverhandlungen führt und gleichzeitig die Genehmigung erteilt, anstatt dass zwei unterschiedliche Behörden beteiligt sind. Außerdem geht es bis hin zu den Energieaudits, die wir nun nach den neuen europäischen Vorschriften durchführen müssen. Darüber hinaus haben wir viele weitere kleine Punkte aufgelistet.“