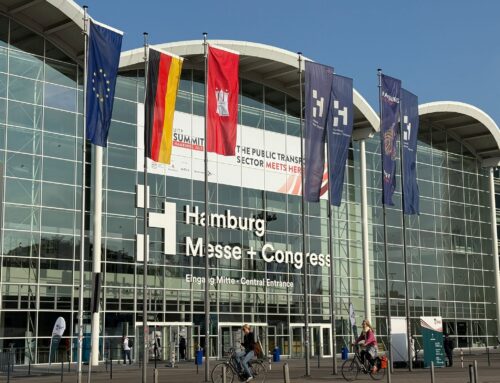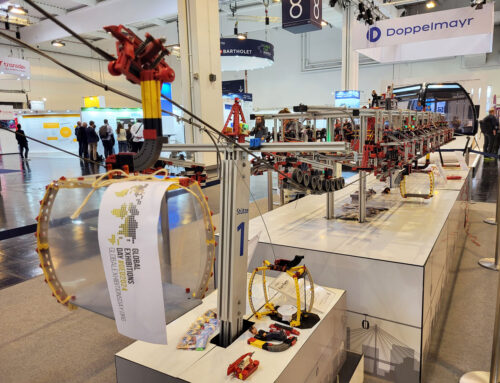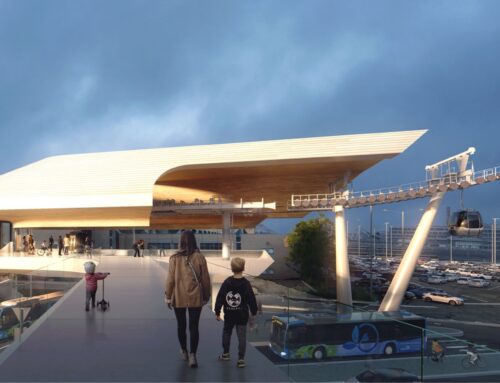Stadt
Solidarische Mobilität: Wie wird Mobilität nachhaltig?
Mit Blick auf den Klimawandel und die fortschreitende Urbanisierung ist der tiefgreifende sozial-ökologische Umbau unserer Wirtschafts- und Lebensweise nahezu Konsens in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft – zumindest in Europa.
Trotz des Wissens um den sozial-ökologischen Gestaltungsbedarfs klafft jedoch eine Lücke zwischen den Leitbildern – etwa Verkehr vermeiden, verlagern und effizienter machen – und dem realen Tun.
„Dies ist auf die tief verankerte imperiale Produktions- und Lebensweise zurückzuführen“, ist Politikwissenschaftler Ulrich Brand überzeugt.
Der Professor an der Universität Wien verweist beispielhaft auf den automobilen Konsens.
So wurden in Österreich 2019 105.000 SUV und Geländewagen zugelassen, aber nur 26.000 Autos mit alternativen Antrieben, wie Wasserstoff oder Elektro.
Zudem werde das auto- und flugzeugzentrierte Transportsystem nicht nur in Österreich durch Straßen,- Tunnel- und Flughafenausbau weiter zementiert.
Die imperiale Lebensweise
Das Hauptproblem der Nachhaltigkeit – an das sich etwa die Politik nicht herantraut – ist laut Brand die imperiale Produktions- und Lebensweise.
Sie äußere sich im alltäglichen, ausgreifenden Zugriff auf globales Arbeitsvermögen und Natur via dem Weltmarkt.
„Sie ist nicht bewusst böse, sondern pure Gewohnheit“, sagt Brand lapidar. Und das überproportional im Weltmaßstab.
„Die imperiale Lebensweise wird politisch, rechtlich, ideologisch und mitunter offen gewaltförmig abgesichert. Auch die unternehmerische Praxis tendiert dazu, teilweise wird jedoch dagegengesteuert“, so Brand.
Die imperiale Lebensweise vertiefe sich tendenziell in kapitalistischen Zentren und breite sich – etwa in China – räumlich aus. Ganz nach dem Motto: Wie im Westen so auf der Erde.
„Die imperiale Lebensweise bestimmt unsere Vorstellungen von ‚gutem Leben‘ und gesellschaftlicher Entwicklung“, betont der Politikwissenschaftler. Sie sei gesellschaftlich tief verankert, verbunden mit Interessen, Macht sowie dem Profitprinzip – und manifestiere sich in täglichen Praktiken, Status und Erfolg. Es sei selbstverständlich, unnachgiebig zu leben.
Das Auto
ist tief in der Lebensweise der Menschen verankert. Foto: Pixabay

Mit dem SUV zum Bio-Bauern
„Wenn wir über Mobilität in der Zukunft sprechen, beschäftigen wir uns also nicht nur mit der Frage des Umweltbewusstseins“, so Brand. Denn das Auto ist beispielsweise nicht nur ein funktionales Fortbewegungsmittel, sondern auch Status, Freiheitsversprechen und Männlichkeit.
„Mit dem SUV kann mir nichts passieren, ich komme sicher durch – auch zum Biobauern“, bringt der Politikwissenschaftler die Widersprüche auf den Punkt.
Viele würden umweltbewusst leben wollen, setzen aber im Alltag auf das ressourcen-intensive Mobilitätssystem von Auto und Flugzeug, welches enorm viel Lärm erzeugt und Fläche verbraucht.
„Wir haben hier ein falsches, individualistisches und negatives Verständnis von Freiheit. Die Bedingungen der imperialen Auto-Mobilität sind einkommens- und ortsabhängig. Zudem wird Mobilität oft erzwungen“, ist Brand überzeugt.
Solidarische Mobilität
Um Mobilität sozialer und nachhaltiger zu machen, brauche es daher zwei Erzählungen für die sozial-ökologische Transformation:
„Einerseits dürfen wir die grüne Ökonomie als Modernisierungsprozess erkennen – und die Chancen und Grenzen sehen. Andererseits müssen wir die solidarische Produktions- und Lebensweise im offenen Prozess aushandeln!“, so Brand.
Das Ziel müsse Mobilität für alle sein – und nicht das große Auto für alle: „Der Kurztrip nach Mallorca oder die Fahrt mit dem SUV muss peinlich werden!“ Dazu müssten Mobilitätszwänge reduziert und auch Produkte jenseits des E-Autos diversifiziert werden.
„Wir dürfen die Mobiliätsangebote nicht dem Markt allein überlassen. Klare Regeln, Anreizsysteme und Subventionen sind gefragt“, sagt Brand.
Zeitgleich müssten Investitionen für Autobahnen und Flughäfen gestoppt, sowie Parkplätze rückgebaut werden. Das Leitbild der autofreien Stadt solle für ein gutes Leben für alle sorgen – und nicht eines auf Kosten anderer.
Politikwissenschaftler Ulrich Brand
fordert solidarische Mobilität. Foto: SI Urban/Surrer

Umgang mit den Verlierern
Brand ist sich aber bewusst, dass der Umbau keine Win-Win-Situation ist. Denn gibt es keine Alternative, dann gibt es viele Gegner:
„Wir müssen uns auf Konflikte einstellen, viele Menschen werden verlieren, wenn sie nicht unterstützt werden.“
Der Politikwissenschaftler denkt hier an die Tausenden Beschäftigten der Verlierer-Industrien und an starke Kapitalgruppen – aber auch an die autoliebende Bevölkerung. Hinzu kämen Finanzierungskonflikte in und nach der Coronakrise.
„Wir brauchen keine Verbote, sondern Regeln, keine Mobilität auf Kosten anderer oder auf Kosten der Natur. Sondern ein positives Freiheitsverständnis“, schließt Brand.